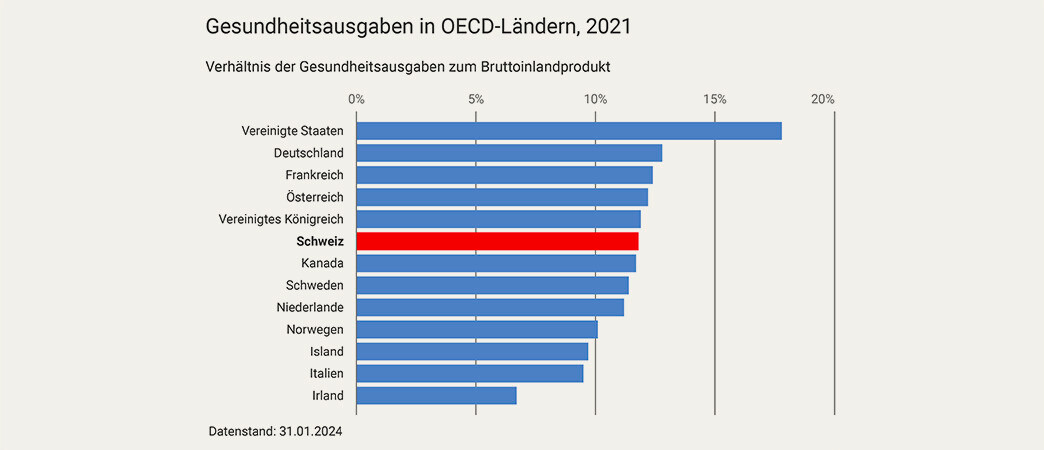Swiss Health Web
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
+41 (0)61 467 85 55
support@swisshealthweb.ch
www.swisshealthweb.ch
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
+41 (0)61 467 85 55
support@swisshealthweb.ch
www.swisshealthweb.ch



Unverändert hohe Zahlen in allen Bereichen und viele personelle Wechsel – 2023 war für das SIWF ein intensives und stürmisches Jahr. Es war aber auch geprägt von Highlights und Erfolgen. Angesichts des vielen frischen Schwungs blickt das SIWF zuversichtlich in die Zukunft.



Der Klimawandel ist im medizinischen Alltag angekommen. Wie sich dieser in der klinischen Tätigkeit äussert, welche Massnahmen dagegen umgesetzt werden, welche Probleme dabei noch unbeantwortet sind und welche Wünsche dazu aufkommen, haben der VSAO und die FMH in einer Umfrage bei den Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzten erhoben.

Ein Aufenthalt im Krankenhaus und Bettlägerigkeit gehen oft Hand in Hand. Studien haben ergeben, dass die Immobilität nicht ohne Folgen für die gesundheitlichen Komplikationen im Krankenhaus ist. Um Patientinnen und Patienten in Schwung zu bringen, hat das Freiburger Spital (HFR) ungewöhnliche Aktivitäten eingeführt – beispielsweise ein Escape Game.